Therapie kann Regulation verändern und Bewegung wieder möglich machen. Langfristige Belastbarkeit entsteht jedoch dort, wo Muskulatur und fasziales Gewebe durch wiederholte mechanische Reize gefordert werden und sich über Zeit anpassen.
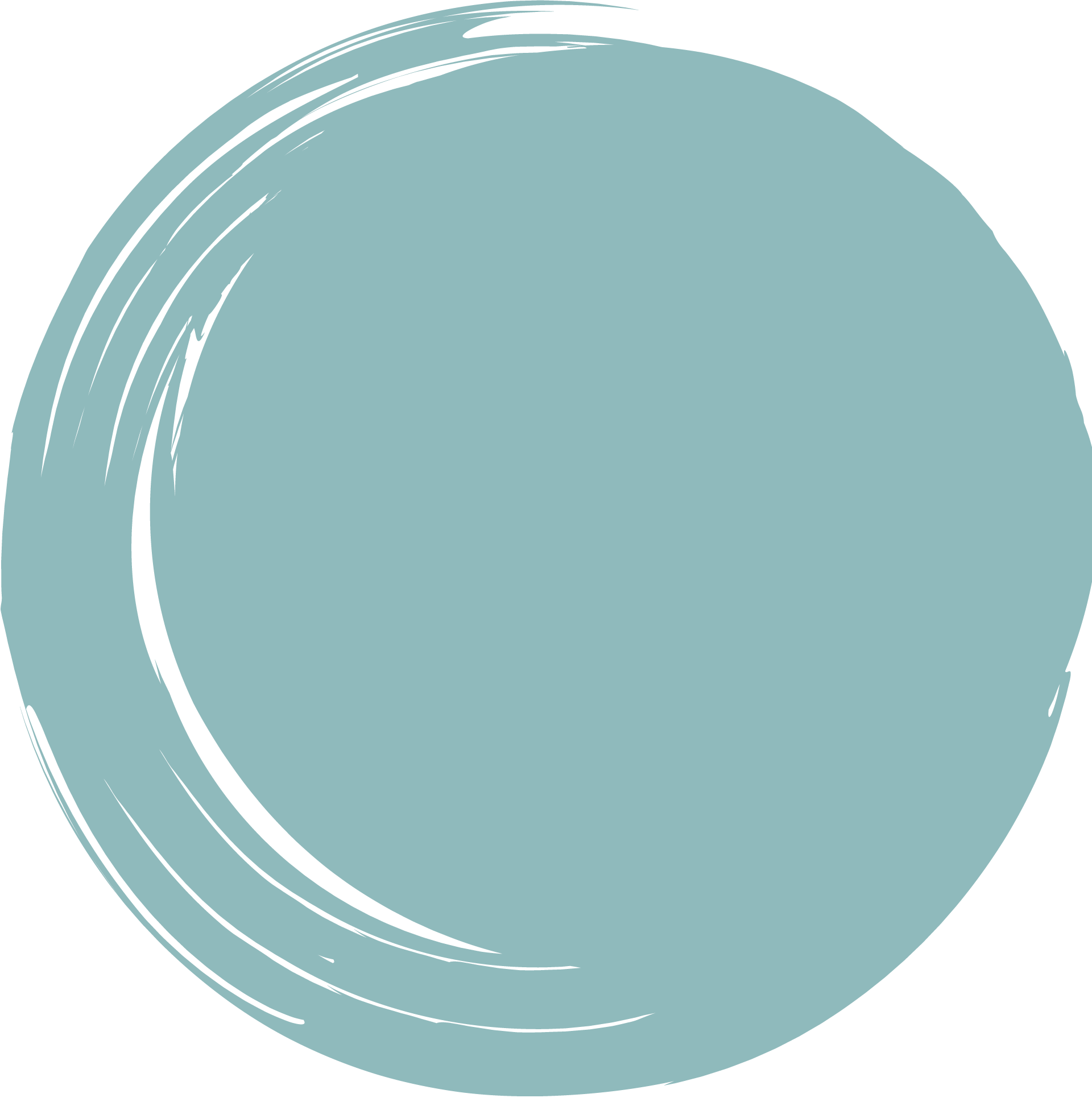
FemSportsHealth

von Dr. Christine Lohr
Warum HIIT kein Krafttraining ersetzt. Was Muskelanpassung wirklich braucht
Viele Trainingsformate fühlen sich intensiv an, setzen aber keinen ausreichenden mechanischen Reiz für eine nachhaltige Muskelanpassung. Der Beitrag zeigt, warum HIIT Krafttraining nicht ersetzt und welche Trainingsreize für Muskulatur, Knochen und Stoffwechsel tatsächlich wirksam sind.
Gelenkschmerzen in den Wechseljahren. Ursachen, Mechanismen und fundierte Einordnung
Gelenkschmerzen in den Wechseljahren entstehen selten durch Verschleiß allein. Hormonelle Veränderungen beeinflussen Entzündungsprozesse, Gewebequalität und die Schmerzverarbeitung und erklären, warum Beschwerden auch ohne strukturelle Schäden auftreten können.
Profitieren Frauen stärker von Sport?
Körperliche Aktivität zählt zu den wirksamsten präventiven Maßnahmen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine große populationsbasierte Studie zeigt, dass Frauen bei vergleichbarem Bewegungsumfang eine stärkere relative Reduktion der Gesamt- und kardiovaskulären Mortalität erreichen als Männer. Der Beitrag ordnet diese Ergebnisse ein und zeigt, was sie leisten und was nicht.
Osteopathie und Geschlechterbias. Ein Blick auf Modelle, Gewebe und Wahrnehmung
Die Grundlagen, auf denen viele osteopathische Modelle beruhen, wurden überwiegend am männlichen Körper entwickelt und bilden weibliche physiologische Vielfalt nur unzureichend ab. Moderne Forschung zeigt jedoch, dass Faszien, Sehnen und sensorische Verarbeitung deutlich hormonabhängig und dynamisch reagieren, was traditionelle Annahmen zu Gewebe, Spannung und Wahrnehmung infrage stellt. Eine zeitgemäße Osteopathie muss diese Erkenntnisse integrieren, um Frauen nicht nur mitzubehandeln, sondern tatsächlich mitzudenken.
Protein realistisch betrachtet. Eine fundierte Einordnung für aktive Frauen
Protein realistisch betrachtet bedeutet, die physiologischen Veränderungen dieser Lebensphase mit dem eigenen Aktivitätsniveau in Verbindung zu bringen. Eine ausreichende und gut verteilte Proteinzufuhr unterstützt Muskulatur, Stoffwechsel und Regeneration und wirkt besonders dann, wenn sie mit gezielten Trainingsreizen kombiniert wird. Der Fokus liegt nicht auf maximaler Optimierung, sondern auf einer ausgewogenen Versorgung, die den Körper im Alltag unterstützt.
Brustkrebsrisiko unter HRT: Was Studien wirklich zeigen
Das Brustkrebsrisiko unter menopausaler Hormontherapie, oft als HRT oder MHT bezeichnet, wird häufig überschätzt, weil meist nur relative Zahlen genannt werden. In der WHI-Studie lagen unter kombinierter Therapie etwa 38 statt 30 Fälle pro 10000 Frauenjahre vor. Moderne Daten zeigen klare Unterschiede zwischen Präparaten, Gestagenen und Applikationsform. Mikronisiertes Progesteron weist dabei eine günstigere Sicherheitslage auf, während Lebensstilfaktoren wie Körperfett, Alkohol und Bewegung das Brustkrebsrisiko stärker beeinflussen als viele HRT-Formen.
GLP-1 und Muskelverlust: Risiken, Reboundphase und Auswirkungen auf Herz und Knochen
GLP-1-Agonisten wie Semaglutid und Tirzepatid führen nicht nur zu Fettverlust, sondern auch zu einem relevanten Verlust an Muskelmasse und Knochendichte. Besonders für Frauen in der Lebensmitte, deren Muskel- und Knochenstruktur sich ohnehin verändert, können diese Effekte bedeutsam sein. Studien zeigen zugleich, dass Krafttraining und eine proteinorientierte Ernährung die Körperzusammensetzung stabilisieren und negative Effekte einer GLP-1-Therapie deutlich abmildern können.
HRT und FDA: Neubewertung der Hormonersatztherapie 2025
Die FDA hat ihre Bewertung der hormonellen Therapie im Klimakterium grundlegend überarbeitet und damit einen bedeutsamen Impuls für die internationale Diskussion gesetzt. Die Entscheidung basiert auf aktueller Evidenz, die zeigt, dass Zeitpunkt, Applikationsform und individuelle Gesundheitsfaktoren das Risiko-Nutzen-Profil deutlich beeinflussen. Für Europa und Deutschland entsteht daraus die Aufgabe, bestehende Empfehlungen kritisch zu überprüfen und verlässliche Aufklärung stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Der Wandel eröffnet die Chance, Frauen in der Lebensmitte besser zu unterstützen und veraltete Narrative hinter sich zu lassen.
Wissen im Wandel: Wie sich Vorstellungen über Frauenkörper im Sport vernetzen
Wissen über Frauenkörper im Sport entsteht im Zusammenspiel von Forschung, Training und gesellschaftlichen Vorstellungen. Eine neue Studie zeigt, wie unterschiedlich Informationen über Stärke und Hormone zirkulieren. Besonders beim zyklusbasierten Training wird deutlich, dass nicht der Zyklus allein die Leistung prägt, sondern das Zusammenspiel von Ernährung, Schlaf, Stress und individueller Reaktion.
